 |
|
|
|
Markuskirche ist eine "offene
Kirche"
Allein in Deutschland gibt es über 20.000
Kirchen und Kapellen, eine Vielzahl von ihnen ist inzwischen auch wochentags
geöffnet und lädt zum Menschen zum Verweilen und Innehalten ein. Und viele
nutzen die Gelegenheit und kommen unter der Woche kurz "auf einen Sprung"
vorbei: Vor dem Einkauf, nach der Arbeit, in der Mittagspause. Sie setzen
sich für einige Minuten in eine Kirchenbank, zünden eine Kerze an, schreiben
ein Gebet oder eine Bitte in ein Anliegenbuch. Und nehmen sich vielleicht am
Ausgang noch eine Karte mit einem Bibelvers oder einen kleinen Kirchenführer
mit.
|
|
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Markuskirche
zu einem Gottesdienst, zu einer Kirchenführung oder über unsere Homepage besuchen!
Haben Sie etwas Zeit für einen Rundgang durch diese „junge“ und schlichte
Kirche, die durch die Formsprache und Symbolik, die sie enthält, gleichwohl
zu uns zu sprechen beginnt...? Sie sind eingeladen!
| |
|
 |
Außenansicht
Die heutige Kirche
mit den beiden Seitenschiffen und dem kurzen Turm wirkt gedrungen.
Diese Kirche hat einmal anders
ausgesehen:
|
 |
|
1891 war sie erbaut worden, damals die erste evangelische Kirche
Gaggenaus: wesentlich kleiner und mit hohem schlankem Turm. |
| |
Die Geschichte der evangelischen
 Gemeinde in Gaggenau begann 1771: Gemeinde in Gaggenau begann 1771:
Die
katholische Linie des Hauses Baden war ohne Stammhalter geblieben und
erlosch. Da fiel die obere Markgrafschaft Baden-Baden an Karl Friedrich von Baden-Durlach, der evangelisch war. Bis dahin gab es in der Region nur in
Gernsbach eine evangelische Gemeinde und einen Pfarrer. Immer dann, wenn der
Markgraf Karl Friedrich von Baden-Durlach in der Folgezeit im Schloss von
Rotenfels residierte, wurde der evangelische Pfarrer von Gernsbach nach
Rotenfels zu Hausandachten ins Schloss gerufen. Aus den Hausandachten wurden
später regelmäßige Gottesdienste. Die Hofbediensteten, die Gäste und erste
Einwohner mit evangelischem Bekenntnis bildeten die Gemeinde.
Danach, im Zug der Industrialisierung Gaggenaus, zogen die Betriebe und
Unternehmen Menschen aus allen Gegenden an, darunter viele evangelischen
Bekenntnisses. Die Kirchengemeinde wuchs kontinuierlich; nach dem Krieg
kamen viele Evangelische, die ihre Heimat im Osten verlassen mussten, hinzu.
Das
Kirchenportal: Übergang in eine andere Welt
Das Portal einer Kirche ist, je nach Bauzeit
 und Epoche, mehr oder weniger
reich ausgestaltet. Unsere recht „moderne Kirche“ hat kein aufwändiges
Portal, doch das Portal ist bei sakralen Bauten grundsätzlich bedeutsam,
weil es den Eintritt in einen anderen Raum bewusstmacht. Das Kirchenportal
signalisiert den Übergang in einen anderen Raum, und damit in eine andere
Welt. und Epoche, mehr oder weniger
reich ausgestaltet. Unsere recht „moderne Kirche“ hat kein aufwändiges
Portal, doch das Portal ist bei sakralen Bauten grundsätzlich bedeutsam,
weil es den Eintritt in einen anderen Raum bewusstmacht. Das Kirchenportal
signalisiert den Übergang in einen anderen Raum, und damit in eine andere
Welt.
Bemerkenswert ist, dass wir ziemlich intuitiv beim Betreten eines
Kirchenraums eine andere Haltung einnehmen und oft auch in eine andere
Stimmung versetzt werden. Mit dem Begriff „heilig“ könnte man das „andere“
des Kirchenraums benennen, was auch Menschen wahrnehmen, die keine
kirchliche Sozialisation erfahren haben, wenn sie eine Kirche betreten.
Selbst Jugendliche verhalten sich anders in diesem Raum...
Vielleicht könnte man es so formulieren: Der Kirchenraum spiegelt mir wider,
dass es in meinem Leben etwas Heiliges gibt, dass es Dinge gibt, die mir
heilig sind und die das menschliche Leben aus dem bloß materialistischen
Dasein erheben und ihm eine unverlierbare Würde geben: es geht um das, was
schützenswert ist in unserm Leben und im menschlichen Leben und in der Welt
überhaupt. Insofern weisen uns Kirchen immer auf dies „Überschüssige“ im
Leben hin, das nicht messbar und sichtbar ist...
 |
Sollte Gott an Kirchenmauern gebunden sein?
Dennoch ist bereits in biblischen Zeiten eine bemerkenswerte Zurückhaltung
erkennbar, die Gegenwart Gottes an ein sakrales Gebäude (damals den Tempel
in Jerusalem) zu binden:
Nachdem der König Salomo den Tempel in Jerusalem errichtet hatte, sprach er
am Altar folgendes Gebet:
Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel
und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen – wie sollte es dann dies
Haus tun, das ich gebaut habe?
|
Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem
Flehen, Herr, mein Gott:
Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Nacht und
Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast: da soll mein Name sein.
Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte
betet und wollest erhören das Flehen deines Knechts und deines Volkes
Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte; und wenn du es hörst
in deiner Wohnung, im Himmel, wollest du gnädig sein.“
(1. Könige Kapitel 8 Verse 27-30)
Die Gegenwart Gottes in unseren Gottesdiensten und Zusammenkünften können
wir also erbitten, aber sie ist nicht automatisch verfügbar. Grundsätzlich
gilt: Gottes Wirken ist gewiss nicht an die Kirchenmauern gebunden!
|
| |
|
|
|
|
|
Die Fenstermotive im Kirchenschiff:
die 4 Evangelisten sind paarweise angeordnet; jeweils im mittleren Fenster
befinden sich die Symbole Schwert und Schlüssel einander gegenüber:
|
Löwe
= Markus |
Adler
= Johannes |
|
Schwert = Paulus / weltliches Regiment |
Schlüssel = Petrus / geistliches Regiment (Schlüsselgewalt) |
|
Engel = Matthäus |
Stier = Lukas |
|
„ELSA“ (Engel – Löwe – Stier – Adler) ist ein
Kürzel, um sich die Reihenfolge der Evangelisten bzw. Symbole zu merken.
|
 |
Der Engel steht für den Evangelisten Matthäus
(das erste
Evangelium unter den vier neutestamentlichen Evangelien), weil in der
Geburtsgeschichte Jesu nach Matthäus Engel eine herausragende Rolle spielen:
Ein Engel kündigt dem Josef im Traum die Geburt Jesus an, ein Engel warnt
ihn nach der Geburt des Kindes vor Herodes und weist ihn an, mit Maria und
Jesus nach Ägypten zu fliehen, wiederum ist es ein Engel, der Josef in
Ägypten anzeigt, dass er mit der Familie in die Heimat zurückkehren kann.
|
|
Der Löwe ist Symbol des Evangelisten Markus:
Der Löwe, der mit dem Schweif seine Spuren verwischt, ist Sinnbild für
die geheimnisvolle Herkunft Jesu, die Menschwerdung Gottes. Im
Markusevangelium ist das Geheimnis der Person Jesu in besonderer Weise
betont. |
 |
 |
Der Stier,
wichtiges Opfertier im Tempelkult des Alten
Testaments, kennzeichnet Lukas: sein Evangelium beginnt mit dem Opfer, das
Zacharias Gott darbringt.
|
|
Der Adler,
Symbol für die geistige Kraft der Heiligen
Schrift steht für das Johannesevangelium: Dies Evangelium ist am
deutlichsten an theologischer Interpretation interessiert, weniger an den
bloßen Tatsachen. |
 |
Der Schlüssel und das Schwert stehen sich im Kirchenschiff
rechts und links gegenüber:
 |
Der Schlüssel
bezeichnet den Jünger und Apostel Petrus, dem Kopf der Jerusalemer
Urgemeinde, dem Jesus nach der Überlieferung des Evangeliums
stellvertretend für alle Jünger die „Schlüsselgewalt“, also die
geistliche Gewalt anvertraut: „Ich will dir die Schlüssel des
Himmelreichs geben: alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im
Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch
im Himmel gelöst sein.“
(Matthäusevangelium Kapitel 16 Vers
19)
|
|
Das Schwert
kennzeichnet wohl den Apostel Paulus: es
erinnert an Saulus, den Christenverfolger, der sich zum streitbaren
Verfechter des neuen christlichen Glaubens wandelt; Paulus verdanken wir die
Gründung der ersten „heidenchristlichen“ Gemeinden.
|
 |
Die Symbole Schlüssel und Schwert lassen sich auch als Zeichen
für die weltliche und geistliche Gewalt deuten:
Gott regiert nach der lutherischen „Zwei-Reiche-Lehre“ die Welt mit zwei
Händen: mit der einen Hand durch das „weltliche Regiment“, also durch
Rechtsprechung, Strafe, Gewalt zur Aufrechterhaltung der weltlichen Ordnung,
mit der andern Hand durch das „geistliche Regiment“: durch Christus zur
Erlösung der Menschen durch sein Wort und Sakrament.
Es ist sinnig, dass die beiden Symbole sich im Kirchenschiff befinden, wo
die Christen sitzen: sie sind Bürger sowohl des Reiches Gottes als auch des
weltlichen Staates und im Kirchenraum ist sinnlich nachvollziehbar, dass
dies manchmal zu einem spannungsvollen Spannungsverhältnis führt.
Die Fenstermotive im Chorraum:
|
Linke Empore oben: |
Rechte Empore unten: |
Rechte Empore oben: |
|
|
Kreissymbol = Gemeinschaft oder Lebenszyklus? |
Weihnachtsstern |
|
Taube = Taufe, Hl. Geist, Pfingsten |
Lutherrose = Glaube |
Abendmahlskelch |
|
|
Hand mit Herz = Nächstenliebe, Diakonie |
Offenes Grab, Ostern |
|
Richtung Norden: |
|
Richtung Norden: |
|
Kreuz mit Schlange = Überwindung der Sünde |
|
Wappen der Familie Bach |
Auch die dargestellten Fenstermotive unter und auf den Emporen im Chorraum
sind systematisch angeordnet:
 |
Kreuz mit Schlange
= Überwindung der Sünde
(Philipp Melanchthons selbstgewähltes Familienwappen) |
|
Das
Wappen der Familie Bach ist sinnigerweise von der Orgel aus
sichtbar |
 |
 |
Die Lutherrose unter der rechten Empore, das vom Reformator
selbst gewählte Wappen, bringt Luthers Glaubenslehre zum Ausdruck. In einem
Brief am 8. Juli 1530 beschreibt Martin Luther sein Wappen:
„Das erste sollte ein Kreuz sein – schwarz – im Herzen, das
seine natürliche Farbe hätte. Denn so man von Herzen glaubt, wird man
gerecht... Solch Herz soll mitten in einer weißen Rose stehen, anzeigen,
dass der Glaube Freude, Trost und Friede gibt... darum soll die Rose weiß
und nicht rot sein; denn weiße Farbe ist der Geister und aller Engel Farbe.
Solche Rose steht im himmelfarbenen Feld, dass solche Freude im Geist und
Glauben ein Anfang ist der himmlischen Freude zukünftig... Und um solch ein
Feld einen goldenen Ring, dass solche Seligkeit im Himmel ewig währt und
kein Ende hat und auch köstlich über alle Freude und Güter, wie das Gold das
edelste köstlichste Erz ist...“
|
Der Glaube hat als
notwendiges Pendant das Tun, die tätige Nächstenliebe, symbolisiert durch
eine Hand, auf der sich ein Herz befindet
(„ein
Herz für jemanden haben“).
(Johannes Calvins Wappen nach dem Wahlspruch: Mein Herz biete ich dir dar, o Herr, bereitwillig und aufrichtig)
|
 |
 |
Das dritte Symbol in dieser
Reihe, ein Kreis in gelb und schwarz
gestaltet,
ist uneindeutig: Es könnte für Gemeinschaft stehen; so würde
so die Dreiheit Glaube – Diakonie – Gemeinschaft (Koinonia) drei
zusammengehörige Aspekte des christlichen Lebens darstellen.
(Ulrich Zwinglis ererbtes Familienwappen) |
Die
Dreiheit Kanzel – Altar – Taufbecken
Wenn man Kanzel, Altar und Taufbecken mit gedachten Linien miteinander
verbindet, ergibt sich in den meisten Kirchen ein Dreieck. Diese Dreiheit
lässt sich auf elementare Vollzüge im menschlichen Leben deuten: Ansprache –
Essen – Waschen: alle drei Vollzüge sind notwendig am Lebensbeginn, aber
auch im weiteren Lebensverlauf...
Man kann auch anders sagen: die Vollzüge des Gottesdienstes (Predigt,
Abendmahl, Taufe) ermöglichen eine Regression, die wir als erwachsene
Menschen regelmäßig brauchen, um progressiv, gestaltend und verantwortlich
leben zu können...
Diese Vollzüge drücken eine bestimmtes Menschenbild aus: Der Mensch ist ein
elementar auf andere angewiesenes soziales Wesen, auch noch im
Erwachsenenalter.
|
 |
 |
Abendmahlsgeräte
Zur festlichen Einweihung der Markuskirche am 19. Nov.
1891 überreichte Großherzog Friedrich I. die Abendmahlsgeräte als
Geschenk an die Kirchengemeinde.
Seither haben sich über ein Jahrhundert
hinweg Gemeindeglieder und Gäste zur Feier des Abendmahls um den Altar
versammelt.
|

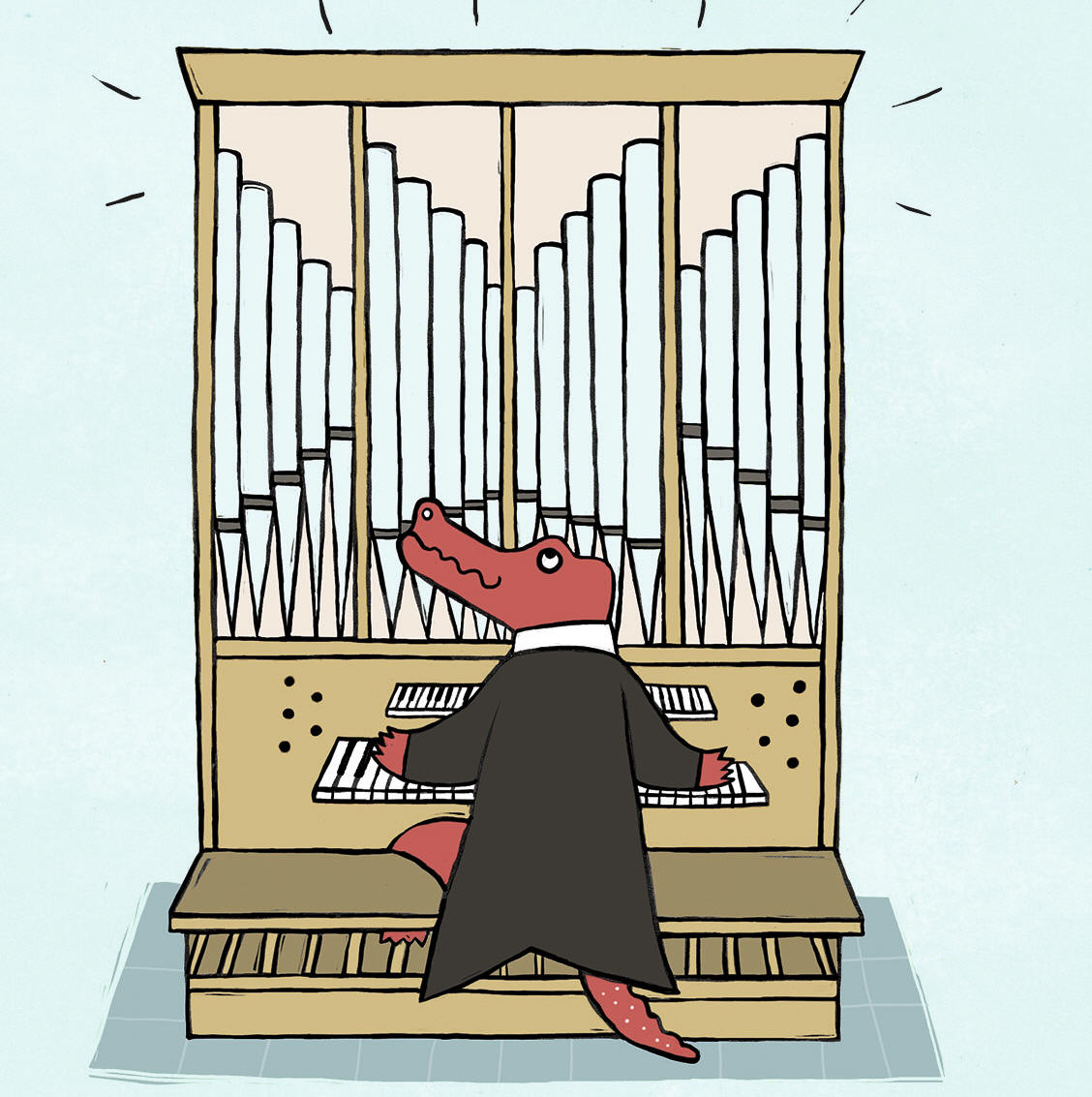
|
Die
Orgel
Nach zähem Ringen konnte sich der Ältestenkreis im Jahr
1994 für einen Orgelneubau in der Markuskirche entscheiden. Es war keine
leichte Entscheidung. Die alte Orgel der Firma Steinmeyer zu erhalten,
wäre zwar „billiger“ (200.000.- DM) gewesen, aber hätte langfristig
dieselben Probleme aufgeworfen, mit denen man bis 1994 zu kämpfen hatte.
Die Firma Hartwig Spät in Hugstetten am Kaiserstuhl erhielt
den Zuschlag und der Vertrag wurde Ende 1994 unterzeichnet. Es sollten nun
noch vier Jahre ins Land gehen bis zum Einbau der Orgel.
Im November 1997 wurde die „alte Steinmeyer“ von einem
Orgelbauer aus Bratislava abgebaut. Sie tut heute in der Lutherischen Kirche
in Bratislava noch ihren Dienst. 12.000.- DM bekam die Gaggenauer Gemeinde
noch für das alte Instrument.
Derweil ging in der Markuskirche der große Umbau und die
Renovierung der Kirche von statten. Am 30. Juni 1998 war es dann so weit.
Die neue Orgel wurde angeliefert und aufgebaut.
Zum Instrument:
Es handelt sich um eine voll mechanische Schleifladenorgel
mit 21 Registern. Das Konzept basiert auf den Ideen des
Orgelbausachverständigen Herrn Dr. Kares. Die Disposition weicht in einem
Punkt von den üblichen Schemata ab. Das Pedalwerk wird nicht wie üblich mit
30 Tönen gebaut sondern als Manualwerk. Das Pedal ist somit nur über eine
Kopplung spielbar. Dieser neue Aspekt fasziniert, da man dadurch ein
zusätzliches drittes Manual auf 16’ Basis zur Verfügung hat. Das gesamte
Pedal (III. Manual) ist gemeinsam mit dem zweiten Manual in einem
Schwellkasten untergebracht und ermöglicht eine zusätzlich expressive
Nutzbarkeit. Der Gesamtklang der eigentlich zweimanualigen Orgel erhält
durch das Bassmanual ein wesentlich erweitertes Klangbild, das man
eigentlich von einer Orgel dieser Größe normalerweise nicht erwarten würde. |
Zum
Schluss eine heutige Stimme
Bevor Sie sich auf den Rückweg machen und unsere Kirche verlassen, lesen Sie
noch ein modernes Bekenntnis zur Bedeutsamkeit der Kirchen und zu all dem,
wofür Kirchen stehen:
„Ich möchte nicht in einer Welt ohne Kathedralen leben. Ich
brauche ihre Schönheit und Erhabenheit. Ich brauche sie gegen die
Gewöhnlichkeit der Welt. Ich will zu leuchtenden Kirchenfenstern hinaufsehen
und mich blenden lassen von den unirdischen Farben. Ich brauche ihren Glanz.
Ich brauche ihn gegen die schmutzige Einheitsfarbe der Uniformen. Ich will
mich einhüllen lassen von der herben Kühle der Kirchen. Ich brauche ihr
gebieterisches Schweigen. Ich brauche es gegen das geistlose Gebrüll des
Kasernenhofs und das geistreiche Geschwätz der Mitläufer. Ich will den
rauschenden Klang der Orgel hören, diese Überschwemmung von überirdischen
Tönen. Ich brauche ihn gegen die schrille Lächerlichkeit der Marschmusik.
Ich liebe betende Menschen. Ich brauche ihren Anblick. Ich brauche ihn gegen
das tückische Gift des Oberflächlichen und Gnadenlosen. Ich will die
mächtigen Worte der Bibel lesen. Ich brauche die unwirkliche Kraft ihrer
Poesie. Ich brauche sie gegen die Verwahrlosung der Sprache und die Diktatur
der Parolen. Eine Welt ohne diese Dinge wäre eine Welt, in der ich nicht
leben möchte.“
(Aus: Pascal Mercier, Nachtzug nach Lissabon)
|

Evang. Kirchengemeinde Gaggenau,
Eckenerstr. 1a, 76571 Gaggenau, Tel. (07225) 1468
Impressum/Datenschutz
|



